Was ist der PSA-Test und was sagt er bei Prostatakrebs aus?
PSA ist ein wichtiger Blutwert bei Erkrankungen der Prostata
Der PSA-Test ist eine Untersuchung, die einen Hinweis auf den Gesundheitszustand der Prostata gibt. PSA steht für die hierbei im Blut getestete Substanz, das prostata-spezifische Antigen. Das PSA ist ein Bestandteil des Prostatasekrets und ist in kleinen Mengen im Blut nachweisbar. Der PSA-Wert kann bei verschiedenen Erkrankungen der Prostata erhöht sein. Eine besondere Bedeutung hat der PSA-Test bei der Diagnose von Prostatakrebs (Prostatakarzinom). Dabei gilt das PSA als ein sogenannter Tumormarker für das Prostatakarzinom. Die Messung des PSA-Wertes im Blut ist zur Wahl der richtigen Behandlungsmethode sowie später zur Verlaufskontrolle wichtig. Der PSA-Test kommt ebenfalls zur Früherkennung von Prostatakrebs in Betracht. Inwieweit der Test im Rahmen der Früherkennung sinnvoll ist, darüber herrscht unter Fachleuten allerdings Uneinigkeit.
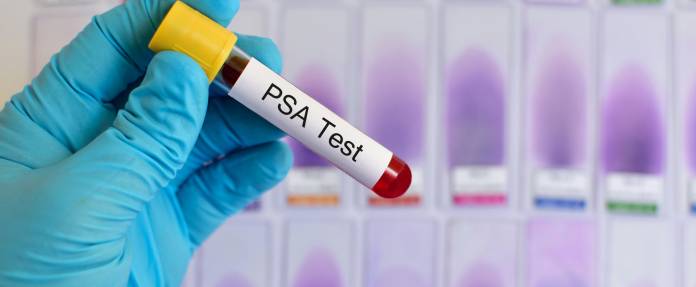
Das PSA ist ein Bestandteil des Ejakulats
PSA oder prostata-spezifisches Antigen ist eine Substanz, die von der Prostata und in geringerem Ausmaß von anderen Drüsen gebildet wird. Das PSA ist nicht nur im Ejakulat des Mannes, sondern auch bei der Frau vorhanden (dort wird es von weiteren Drüsen ausgeschüttet). Die natürliche Aufgabe des PSA ist es, das Ejakulat flüssig zu halten. Prostata-spezifisches Antigen findet sich darüber hinaus im Blut. Je nachdem, wie viel PSA in das Blut abgegeben wird und wie viel der Körper ausscheidet oder abbaut, enthält das Blutserum eine mehr oder weniger hohe Konzentration an PSA.
Der Blutwert für das PSA kann durch verschiedene Gegebenheiten erhöht sein und der hohe Wert muss nicht mit einer Erkrankung zusammenhängen. Zum einen können körperliche Belastungen, die auf die Prostata einwirken, den Wert steigen lassen. Dazu gehören
- Sport
- schwere Arbeit
- Geschlechtsverkehr
- medizinische Behandlungsmaßnahmen
- Operationen.
Zum anderen geht eine Entzündung oder eine Vermehrung von Prostatagewebe wie bei einer gutartigen Prostatavergrößerung (BPH, benigne Prostata-Hyperplasie) oder bei einem Prostatakrebs mit hohen PSA-Blutwerten einher. Im Allgemeinen ist beim Prostatakrebs der PSA-Wert umso höher, je weiter der Tumor fortgeschritten ist. Hohe Werte können zudem auf Absiedlungen des Tumors in anderen Organen hinweisen (Metastasen).
Der PSA-Test ist die Messung des PSA-Wertes im Blut
Für einen PSA-Test wird dem Mann Blut abgenommen. Die Konzentration des PSA im Blutserum wird im Labor festgestellt. Einen exakten Normwert für das PSA gibt es nicht. Im Allgemeinen gilt der Wert als auffällig, wenn er 4 Nanogramm pro Milliliter (4 ng/ml) überschreitet. Einige Mediziner betrachten bereits einen Wert zwischen 2 und 4 ng/ml als problematisch und abklärungswürdig.
Der PSA-Wert gibt lediglich Hinweise auf den Zustand des Prostatagewebes und muss immer im Gesamtzusammenhang betrachtet werden. Als auffällig gilt beispielsweise auch ein ansteigender Wert, wenn mehrere Tests im zeitlichen Verlauf durchgeführt werden. Ein mittelmäßig erhöhter Wert ist besonders bei jungen Männern verdächtig. Gerade ein über mehrere Messungen im Laufe von Wochen hoher PSA-Wert muss mit einer Probeentnahme (Prostata-Biopsie) weiter abgeklärt werden. Selbst bei einem kleinen Wert für das PSA ist ein Prostatakrebs nicht zweifelsfrei auszuschließen. Erst die Prostata-Biopsie mit nachfolgender Laboruntersuchung (Histologie) bringt ein eindeutiges Ergebnis.
Zusammenfassend befürworten die deutschen Leitlinien folgendes Vorgehen nach dem Test:
- bei einem PSA-Wert über 4 ng/ml oder bei fortwährend ansteigenden Werten wird eine Prostata-Biopsie veranlasst (bei jungen Männern bereits bei geringeren Werten)
- bei Werten über 2 ng/ml erfolgt jedes Jahr eine Kontrolluntersuchung
- bei Werten über 1 ng/ml erfolgt alle zwei Jahre eine Kontrolluntersuchung
- bei Werten unter 1 ng/ml erfolgt lediglich auf Wunsch des Mannes alle vier Jahre eine Kontrolluntersuchung (bei Männern älter als 70 Jahre oder mit einer Lebenserwartung von unter 10 Jahren werden keine weiteren Tests vorgenommen)
PSA-Test und dessen Bedeutung für die Prostatakrebs-Früherkennung
Das Prostatakarzinom ist ein häufiger Tumor bei Männern, der in vielen Fällen ein langsames Wachstum und eine verhältnismäßig günstige Prognose aufweist. Das gilt aber nicht bei allen Patienten, denn einige der Tumore wachsen schneller und breiten sich eher aus. Die Aussichten sind dann deutlich schlechter. Metastasen (Tochtergeschwülste) bedeuten, dass eine Heilung nicht mehr möglich ist.
In Deutschland ist für jeden Mann ab 45 Jahren einmal pro Jahr eine Prostatakrebs-Früherkennung angedacht. Diese wird beim Hausarzt oder beim Urologen durchgeführt und von den gesetzlichen Krankenversicherungen bezahlt, in der Regel auch von privaten Krankenversicherungen. Bestandteil der Früherkennungsuntersuchung ist das Arzt-Patienten-Gespräch darüber, ob es Beschwerden oder Auffälligkeiten gibt (die Anamnese), und die körperliche Untersuchung. Dazu gehört die Beurteilung der Leisten- und Schamregion sowie die Abtastung der Prostata über den After vom Darm aus. Bei dieser Abtastung werden allerdings nur große Tumore an den „richtigen“ Positionen der Prostata aufgespürt, die der Arzt erspüren kann. Der PSA-Test ist bei der gesetzlichen Früherkennung von Prostatakrebs nicht vorgesehen. Die Kosten für die PSA-Bestimmung müssen die Patienten selbst zahlen. Der Arzt berät die Männer ab einem Alter von 45 Jahren (oder ab einem Alter von 40 Jahren bei Prostatakrebs-Fällen von Verwandten), inwiefern ein PSA-Test sinnvoll ist.
Der PSA-Test wird allerdings zweifellos in den Fällen gemacht und von der Krankenkasse übernommen, wenn der Arzt bei der Tastuntersuchung der Prostata Auffälligkeiten festgestellt hat. Dann gilt der Test als wichtige Methode zur weiteren Abklärung neben dem Ultraschall, weiteren bildgebenden Verfahren wie MRT (Kernspintomographie) und einer Probeentnahme (Biopsie).
Pro und Contra PSA-Test
Die Sinnhaftigkeit des PSA-Tests bei Männern ohne sonstige Auffälligkeiten wird von einigen Medizinern angezweifelt. Es gibt Argumente für oder gegen den PSA-Test zur Früherkennung von Prostatakrebs. Fraglich ist, ob durch die wiederholte Testung des PSA allgemein eine Lebensverlängerung erreicht werden kann. Umgekehrt könnte bei einigen Männern mit einem auffälligen Testergebnis eine Behandlung durchgeführt werden, die nicht notwendig wäre. Männer müssen sich daher bewusst damit auseinandersetzen, ob sie den PSA-Test durchführen lassen möchten oder nicht.
Vermutlich kann die Sterblichkeit durch die Testung in geringem Ausmaß gesenkt werden. Bei Patienten mit einer aggressiven Unterform von Prostatakrebs, der rasch wächst, kann eine frühzeitige Entdeckung durch die Untersuchung die Aussichten auf eine Heilung und damit die Überlebenschancen erhöhen. Dieses Karzinom findet sich häufiger bei Patienten, bei denen bereits mehrere Männer in der Verwandtschaft von Prostatakrebs betroffen waren oder einer in jüngerem Alter betroffen war (etwa mit 50 oder 60 Jahren) und damit eine erhöhte Wahrscheinlichkeit durch vererbte Merkmale besteht. Dabei ist zu erwähnen, dass bei diesen Patienten der PSA-Test etwas öfter nur gering erhöhte Werte zeigt und der Krebs damit nicht immer früh erkannt werden kann.
Darüber hinaus ist ein Gegenargument zum PSA-Test, dass verhältnismäßig viele Männer ein erhöhtes PSA haben, ohne an Krebs zu leiden. Diese Männer werden dadurch stark verunsichert, ohne krank zu sein. Ebenfalls kann ein nur sehr langsam fortschreitender Prostatakrebs vorhanden sein, der keine Behandlung erfordert. Die Männer bekommen dennoch eine Behandlung, die Nebenwirkungen mit sich bringt. Damit wird der Körper ebenso wie die Psyche beansprucht, ohne dass die Lebenszeit durch die Therapie beeinflusst wird. Kritiker an dem PSA-Test sehen keine Vorteile in der Untersuchung, wenn die Lebenserwartung ohnehin nicht erhöht wird. Das gilt insbesondere für Männer in höherem Alter, bei denen für die Lebenserwartung andere Erkrankungen eine größere Rolle spielen als ein gering bösartiges Prostatakarzinom, das über Jahre bis Jahrzehnte keine Beschwerden und Folgen mit sich bringt. Dies ist der Grund, weshalb beispielsweise in den Vereinigten Staaten den Männern ab 70 Lebensjahren von einem PSA-Test abgeraten wird.
Das Verhältnis zwischen Nutzen und Nachteilen des Tests gilt als begrenzt. Insgesamt wird geschätzt, dass 30 bis 40 Patienten sich aufgrund des Testergebnisses einer Behandlung ohne Nutzen, aber mit Nebenwirkungen unterziehen müssen, um bei einem Betroffenen das Überleben zu verlängern.
Was müssen Männer vor dem PSA-Test beachten?
Das Ergebnis der Blutuntersuchung auf PSA kann durch harmlose Beanspruchungen verfälscht werden. Um den PSA-Test nicht von vornherein hoch ausfallen zu lassen, ist es besser, in den 24 Stunden vor dem Test nicht Rad zu fahren, nicht zu masturbieren und keinen Geschlechtsverkehr zu haben. Dies wird der Untersucher jedoch vorher individuell mitteilen. Einen eindeutigen Beweis, dass diese Aktivitäten den PSA-Wert verändern, gibt es nicht.
Alternativen zum PSA-Test
Ein anderer Test, der durchgeführt werden kann, ist der PCA3-Test. Dabei handelt es sich um einen Urintest, der zeigt, ob ein Tumormarker namens Prostate Cancer Gene 3 vorliegt. Dieser weist zwar genauer auf ein Prostatakarzinom im Vergleich zu gutartigen Vergrößerungen oder Entzündungen hin, ist aber dennoch kein eindeutiger Nachweis. In der Wissenschaft gilt der PCA3-Test als nicht hinreichend sicher, was die Ergebnisse angeht. Daher ist ebenso eine weiterführende Diagnostik mit Probeentnahme (Biopsie) notwendig. In Studien werden diverse weitere Marker erforscht, deren Bestimmung Aufschlüsse über das eventuelle Vorhandensein und die Ausbreitung eines Prostatatumors gibt.
aktualisiert am 16.05.2023



