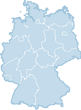Phlegmone
Als Phlegmone (bedeutet im Alt-Griechischen Entzündung) bezeichnet man eine diffuse bakterielle Entzündung des Bindegewebes, die in den meisten Fällen durch Streptokokken oder Staphylokokken ausgelöst wird. Die Bakterien treten beispielsweise durch Wunden, kleinere Verletzungen oder durch Spritzen in die Haut ein und verursachen an der betroffenen Stelle eine eitrige Entzündung, die sich entlang von Unterhaut, Muskeln und Faszien (Bindegewebshüllen) unter der Haut ausbreitet. Infolgedessen kommt es zu starken Schmerzen, Rötung und Schwellung des betroffenen Körperteils sowie zu Fieber und allgemeinem Krankheitsgefühl. Eine Phlegmone tritt häufiger bei Männern als bei Frauen auf und betrifft meist die untere Körperhälfte.


Als Alternative zum Begriff "Phlegmone" ist der Begriff "Zellulitis" häufig als Oberbegriff in Gebrauch. Zellulitis bezeichnet auch eine durch Bakterien verursachte Infektion der Haut. Sie betrifft die oberste Hautschicht (Epidermis), die darunter liegende Lederhaut (Dermis) und das darunter liegende Gewebe. International gibt es keine einheitliche Terminologie für Haut- und Weichteilinfektionen. Oft werden die Begriffe Zellulitis, Phlegmone und Erysipel (Wundrose) synonym verwendet. Während eine Wundrose nur die obersten Hautschichten betrifft, entzünden sich bei einer Phlegmone auch tiefere Hautschichten.
Ursachen
Eine Phlegmone wird durch Bakterien, nämlich β-hämolysierende Streptokokken oder Staphylokokken, ausgelöst. Die Bakterien können durch kleine Verletzungen, Wunden, Geschwüre (auch Druckgeschwüre, so genannter Dekubitus) oder auch Spritzen in den Körper eintreten und eine eitrige Entzündung hervorrufen. Häufig ist sie Folge eines Erysipels (Wundrose) oder einer Operation. Bei geschädigter Haut haben es die Bakterien leichter. Ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht daher bei Hauterkrankungen wie Neurodermitis, Borkenflechte, Pilzinfektionen wie Fußpilz oder bei Wunden und Geschwüren, die bei Menschen mit Diabetes mellitus häufiger auftreten.
Symptome
Die Hauptsymptome einer Phlegmone sind Rötung, Schwellung und Schmerz. Am häufigsten treten Phlegmone am Fuß und Unterschenkel auf. Phlegmone und Wundrose lassen sich optisch gut unterscheiden. Während bei der Wundrose die Rötung scharf begrenzt ist, ist sie bei der Phlegmone weniger scharf begrenzt. Auch ist die Färbung der Phlegmone eher dunkelrot bis violett, während die Wundrose eher hellrot ist.
Da der Eiterherd bei einer Phlegmone (im Gegensatz zum Furunkel) nicht abgekapselt ist, kann sich die Entzündung schnell entlang anatomischer Strukturen wie Unterhaut, Muskeln, Bändern und Faszien (Bindegewebshüllen) ausbreiten. Es entsteht eine großflächige eitrige Entzündung mit starken Schmerzen, Schwellung, Rötung und Überwärmung. Es können auch Fieber, Schüttelfrost und ein allgemeines Krankheitsgefühl auftreten. Eine Phlegmone kann an unterschiedlichen Körperstellen auftreten: Überall unter und in der Haut, entlang von Muskeln, Bändern, Sehnen und Faszien, am Bauchfell (Peritoneum) und am Mittelfell (Mediastinum) in der Brusthöhle. Am häufigsten sind jedoch die Arme und vor allem die Beine betroffen. In seltenen Fällen kann als Folge einer Nasennebenhöhlenentzündung eine Phlegmone am Auge, die so genannte Orbitaphlegmone, auftreten.
Diagnose
Die Diagnose einer Phlegmone wird vor allem klinisch, also anhand der Symptome, gestellt. Meist kommt der Patient mit einem geschwollenen, schmerzenden, überwärmten und geröteten Arm oder Bein zum Arzt. Zur Optimierung der dann folgenden medikamentösen Therapie mit Antibiotika kann ein Abstrich von der betroffenen Stelle genommen werden, um den verantwortlichen Erreger zu bestimmen.
Differenzialdiagnose
In erster Linie muss die Phlegmone von einem Erisypel (Wundrose) abgegrenzt werden, was jedoch nicht immer möglich ist, zumal es auch Mischformen beider Erkrankungen (Erysipelphlegmone) gibt. Im englischsprachigen Raum werden daher auch beide Erkrankungen unter dem Begriff Cellulitis zusammengefasst (bitte nicht mit der auch als Zellulite bezeichneten Orangenhaut verwechseln). Des Weiteren muss die Phlegmone von einer Tiefen Beinvenenthrombose, die ähnliche Symptome wie Schwellung, Rötung und Schmerzen hervorrufen kann, unterschieden werden. Ebenso sollte bei starker Schwellung einer Gliedmaße an ein Lymphödem gedacht werden. Auch banale Ursachen wie ein Insektenstich müssen ausgeschlossen werden.
Behandlung
Die Behandlung hängt von der Schwere der Phlegmone ab.
Behandlung einer begrenzten Phlegmone
Eine begrenzte Phlegmone kann oral mit Antibiotika behandelt werden, wenn kein Fieber und keine systemischen Entzündungszeichen vorliegen und die Infektion lokal begrenzt ist.
Mittel der ersten Wahl ist Amoxicillin/Clavulansäure, bei Penicillinallergie wird Clindamycin empfohlen. Die Behandlungsdauer beträgt in der Regel 5 Tage.
Behandlung einer schweren Phlegmone
Bei schweren Phlegmonen ist neben der antibiotischen Behandlung, die intravenös gegeben wird, eine chirurgische Sanierung notwendig. Sollte es bereits zu einer sichtbaren Eiterbildung und zu einem Einschmelzen der Phlegmone gekommen sein, ist es wichtig, dass der Arzt den Eiter sowie bereits abgestorbenes Gewebe frühzeitig entfernt, die Wunde spült und gegebenenfalls eine Drainage zum Ableiten des Eiters und der Wundflüssigkeit legt. Im Anschluss sollte der betroffene Körperteil hoch gelagert und ruhig gestellt werden. Da dies umso schwieriger ist, je näher sich die Phlegmone am Körperstamm befindet, kann ein Krankenhausaufenthalt unausweichlich sein.
Die medikamentöse Initialtherapie besteht aus Ampicillin/Sulbactam oder Amoxicillin/Clavulansäure, alternativ Cefuroxim und bei Penicillinallergie Clindamycin. Die Behandlung dauert mindestens 7-10 Tage und erfolgt meist im Krankenhaus.
Prognose
Bei frühzeitiger Behandlung und konsequenter Ruhigstellung des betroffenen Körperteils ist die Prognose einer Ausheilung sehr gut. Wichtig ist jedoch die Behandlung und somit Beseitigung von Eintrittspforten für die Erreger, damit keine Rückfälle stattfinden. Wird die Phlegmone nicht behandelt, kann die Entzündung auf Knochen und Gelenke übergreifen, zu einer Entzündung der Lymphgefäße (Lymphadenitis) führen, zu einer nekrotisierenden Fasziitis (eine gefährliche Weichteilinfektion, bei der Gewebe abstirbt) oder im schlimmsten Fall sogar eine Sepsis (Blutvergiftung) auslösen, die tödlich enden kann.
Hinweise für Patienten
Wichtig ist, dass Sie bei dem Verdacht auf eine Phlegmone sofort einen Arzt aufsuchen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, sind die Heilungschancen bei frühzeitigem Therapiebeginn sehr gut. Sie sollten darauf achten, den betroffenen Körperteil zu schonen und, falls möglich, hoch zu lagern. In Absprache mit Ihrem behandelnden Arzt können zusätzlich zur Linderung der Beschwerden kühlende Quarkwickel oder auch feuchte Umschläge mit Arnika- oder Kamillentinktur gemacht werden.
aktualisiert am 29.01.2024

Gesundheitsredakteurin