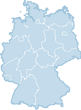Tränenwegstenose
Bei einem Verschluss oder einer Verengung der ableitenden Tränenwege (Tränenwegsstenose) kann es zum überwässerten Auge und zu weiteren Problemen kommen. Eine Operation ist oftmals angezeigt.
Ursachen
Die Tränenproduktion, deren Hauptaufgabe das ständige Befeuchten der Hornhaut ist, findet in der Tränendrüse statt, die im oberen seitlichen Bereich der Augenhöhle sitzt und mehrere Ausführungsgänge besitzt. Die Tränenflüssigkeit sammelt sich zunächst im so genannten Tränensee, einem Flüssigkeitsspiegel im unteren Bereich zur Mitte hin. Die Flüssigkeit wird dann von den Tränenpünktchen aufgenommen, die die Öffnungen der Tränenkanälchen darstellen, die sich am oberen und unteren Lid im inneren Augenwinkel befinden. Die Tränenkanäle münden im Tränensack, der über einen Gang (Tränennasengang) mit der Nasenhöhle (unterhalb der unteren Nasenmuschel) verbunden ist, in die letztendlich die Tränen abfließen.
Ist dieser Abfluss in einem Bereich behindert, liegt eine Tränenwegsstenose vor. Häufig lässt sich eine Ursache für eine Tränenwegsverengung oder einen -verschluss nicht ausmachen. Verschlüsse, die bereits im Kindesalter vorhanden sind, sind in der Regel angeboren, dabei bleibt eine Membran bestehen, die sich normalerweise öffnet. Später können unter anderem Entzündungen eine Tränenwegsstenose bedingen, manchmal ist auch eine Verletzung die Ursache.
Symptome
Hauptsymptom der Tränenwegsstenose ist ein tränendes, überfließendes Auge. Tränen laufen über das Unterlid, durch die vermehrte Flüssigkeit auf dem Auge kann es zu einem Verschwommensehen kommen, was häufig beim Autofahren oder beim Lesen auffällig wird. Manchmal entstehen weiterhin Entzündungen von Tränensack (Dakryozystitis), Tränenkanal und Bindehaut beziehungsweise Lidern. Schleim und Eiter kann sich vor dem Auge absetzen. Bei jahrelang bestehender Tränenwegseinengung oder einem Tränenwegsverschluss kann es durch das ständige Entfernen der Tränen durch den Patienten zu einer Erschlaffung des Unterlids kommen (Wischektropium, Wischentropium).
Diagnose
Nach der Befragung des Patienten (Anamnese) erfolgt eine augenärztliche und HNO-ärztliche Grunduntersuchung. Eine Tränenwegsspülung über das obere und untere Tränenpünktchen ergibt oft schon Hinweise, auf welcher Höhe das Abflusshindernis sitzt, und ob es sich um eine Verengung oder einen Verschluss handelt. Des Weiteren wird eine Ultraschalluntersuchung des Bereiches durchgeführt sowie eine spezielle Röntgenuntersuchung (DCG, Dakryozystographie), bei der man durch eine Tränenwegsspülung ein Kontrastmittel in die Tränenwege einbringt, welches auf dem Röntgenbild die Abflussverhältnisse sichtbar macht.
Differenzialdiagnose
Bei einem erschlafften oder verzogenen Unterlid (Entropium, Ektropium) kann es ebenfalls zu einem verminderten Abfluss von Tränenwasser kommen, da das Tränenpünktchen nicht mehr regelrecht anliegt. Augentränen kann durch viele Arten von Augenreizungen entstehen. Sehr selten ist eine Überproduktion von Tränenflüssigkeit.
Therapie
Konservative Therapie
Durch nichtoperative Maßnahmen lässt sich die Tränenwegsstenose oft nicht erfolgreich bekämpfen. Angeborene Stenosen können im Laufe der Zeit verschwinden. Bisweilen kann auch eine bloße Tränenwegsspülung eine Besserung bringen. Augentropfen und Medikamente sind nur unterstützende Maßnahmen und dienen z. B. der Bekämpfung von Entzündungen.
Operation
Ziel der Tränenwegsoperation ist es, einen Abflussweg zwischen Augenwinkel und Nasenhöhle zu schaffen.
Der Eingriff erfolgt zumeist in Vollnarkose, da eine örtliche Betäubung der Tränenwege in der Regel nicht effektiv ist.
Es bestehen einige verschiedene Operationsmethoden. Die Wahl des Verfahrens richtet sich nach den jeweiligen Umständen und Verhältnissen.
Insbesondere bei Kindern ist oftmals eine Tränenwegs-Intubation ausreichend. Dabei wird ein dünner Schlauch aus Silikon mit speziellen Instrumenten in die Tränenwege eingebracht und die Enden so in der Nasenhöhle miteinander verknotet, dass der Schlauch nicht herausrutschen kann. Der Schlauch dient als Platzhalter und verhindert, dass der Tränenweg wieder in sich zusammenfällt oder zusammenwächst.
In einer anderen Operation (Endonasale Tränenwegsoperation) kann von der Nase aus ein Teil der Knochenlamelle zwischen Nasenhöhle und Tränensack herausgenommen werden sowie Tränensack und Schleimhaut so eingeschnitten werden, dass eine Verbindung hergestellt wird. Dafür muss eventuell zusätzlich der vordere Abschnitt der mittleren Nasenmuschel herausoperiert werden. Bei hochgradiger Verkrümmung der Nasenscheidewand muss diese ebenfalls korrigiert werden, was jedoch selten vorgenommen werden muss. Bei der endonasalen Operation wird ebenfalls ein Silikonschlauch eingeführt. Oft wird für wenige Tage eine Nasentamponade eingelegt, um eventuelle Blutungen auffangen zu können.
Eine moderne und schonende Methode ist die endoskopische Tränenwegsoperation. Dabei wird ein feines optisches Instrument in das Tränenkanälchen eingeschoben, damit der Operateur die Strukturen innerhalb der ableitenden Tränenwege einsehen und beurteilen kann. Eine Schlaucheinlage ohne weitere Maßnahmen kann bereits hinreichend sein, oftmals erfolgt jedoch innerhalb der Tränenwege eine Erweiterung mit einem kleinen Bohrer (Mikrodrillplastik, MDP) oder eine Eröffnung mittels Lasertechnik (Laserdakryoplastik, LDP). Auch nach diesen Maßnahmen erfolgt das Einführen eines Schläuchleins.
Insbesondere nach abgelaufenen Tränensackentzündungen kann eine Tränenwegsoperation von außen (Operation nach Toti) vorgenommen werden. Es erfolgt dazu ein Einschnitt der Haut in der Region des inneren Augenwinkels und der seitlichen Nase. Der Tränensack wird eröffnet, und durch Anlegen eines Knochenfensters wird eine künstliche Verbindung zur Nasenhöhle geschaffen. Die Nasenschleimhaut wird aufgeschnitten und mit der Tränensack-Schleimhaut vernäht. Auch nach dieser OP wird ein Schläuchlein eingelegt. Ebenfalls wird für meist zwei Tage eine Nasentamponade eingelegt, um mögliche Blutungen auffangen zu können.
Darüber hinaus gibt es noch einige sehr spezielle Tränenwegsoperationen, z.B. eine Aufdehnung mit einem kleinen Ballon (Ballondilatation) oder als letzte Möglichkeit bei immer wiederkehrenden Verlegungen die Schaffung einer größeren Verbindung mit einem sogenannten Metaireaux- oder Jones-Tube, einem Plastikröhrchen, das an der Stelle eingelegt wird.
Mögliche Erweiterungen der Operation
Bisweilen zeigt sich erst während der Operation, welche Operationsmethode am sinnvollsten ist. Auch Komplikationen können es erforderlich machen, dass die Operationsmethode abgeändert oder erweitert wird.
Komplikationen
Bei der Tränenwegs-Operation kann es zu Blutungen, Nachblutungen und Blutergüssen kommen. Es kann zu Schwellungen sowie zu meist nicht dauerhaften Sensibilitätsstörungen im Gesicht kommen. Selten können die Tränenwege ebenso wie andere Strukturen, z. B. Lider, Hornhaut oder das Naseninnere, verletzt werden. Sehr selten tritt ein Zugrundegehen oder eine Vertrocknung der Nasenschleimhaut mit sehr unangenehmem Geruch (Stinknase) auf. In wenigen Fällen kann es zu Sehproblemen bis hin zur Erblindung oder zu Doppelbildern kommen. Infektionen, Wundheilungsstörungen und überschießende Narbenbildung können sich ergeben. Allergische Reaktionen unterschiedlichen Schweregrades sind nicht auszuschließen.
Hinweis: Dieser Abschnitt kann nur einen kurzen Abriss über die gängigsten Risiken, Nebenwirkungen und Komplikationen geben und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das Gespräch mit dem Arzt kann hierdurch nicht ersetzt werden.
Prognose
In vielen Fällen sind die Tränenwege nach dem jeweiligen Eingriff wieder durchgängig, und die Symptomatik verschwindet oder bessert sich zumindest. Dennoch kann es vorkommen, dass die Tränenwegsstenose bleibt oder auch später wieder auftritt.
Hinweise
Vor der Operation
Gegebenenfalls müssen Medikamente, die die Blutgerinnung herabsetzen, beispielsweise Marcumar® oder Aspirin®, weggelassen werden. Dies wird mit dem behandelnden Arzt besprochen.
Bei Durchführung der Operation in örtlicher Betäubung darf vier Stunden vorher nicht mehr gegessen und geraucht, zwei Stunden vorher nichts mehr getrunken werden. Bei einer Operation in Vollnarkose erhöht sich die Zeitspanne.
Nach der Operation
Falls die Operation unter ambulanten Bedingungen erfolgt, so muss der Patient beachten, dass er aufgrund der teils noch bestehenden Medikamentenwirkung für 24 Stunden kein Auto, keine anderen Verkehrsmittel und keine Maschinen selbst bedienen darf. Daher sollte er sich abholen lassen. Bedeutsame Entscheidungen sollten ebenfalls vertagt werden.
Die Nase sollte für mehrere Tage nicht geschneuzt werden, um Schäden oder das Herausrutschen des Tränenwegsschlauches zu vermeiden. Besser ist ein Abtupfen von ausfließendem Sekret. Für zwei Wochen sollte sich der Patient keine zu starken körperlichen Anstrengungen vornehmen und je nach Operationsmethode weitere Vorsichtsmaßnahmen beachten. Wärme (auch in Form von heißen Bädern oder Sonnenbädern) kann sich beispielsweise negativ auswirken, und vor Flügen sollte sich der Patient beim Arzt erkundigen.
Das Schläuchlein in den Tränenwegen kann zumeist nach drei Monaten entfernt werden, verbleibt bisweilen aber auch sechs Monate oder ein Jahr. Sollte der Schlauch zuvor herausrutschen, ist dies in aller Regel nicht gefährlich, der Schlauch sollte aber vom Arzt baldmöglichst wieder hineingezogen werden oder vorzeitig entfernt werden.
Zeigen sich Auffälligkeiten, die auf Komplikationen hindeuten, so sollte umgehend der Arzt konsultiert werden.
aktualisiert am 16.11.2023