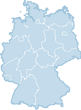Melioidose
Die Melioidose tritt häufig in Reisanbaugebiete auf
Was ist die Melioidose?
Die Melioidose gilt als eine schwer verlaufende, bakterielle systemische zoonotische Infektion mit Multiorganbeteiligung, die meist berufsbedingt auftritt. Als Folge der Überschwemmungen durch den Tsunami Ende 2004 kam es in den Folgemonaten in Indonesien zum vermehrten Auftreten von Melioidosen.

Auch aus Mauritius wurde vor kurzem der erste Fall dieser ingesamt seltenen bakteriellen Infektion gemeldet. Über importierte Infektionen von Reisenden liegen vereinzelte Berichte vor.
Der Erreger der Melioidose
Der Erreger kommt im Erdboden und im Wasser vor und gilt daher als Umweltsaprophyt. Daher sind endemische Gebiete insbesondere in Reisanbaugebieten zu finden. Verursacht wird die Melioidose durch das gramnegative Stäbchenbakterium, Burkholderia pseudomallei (frühere: Pseudomonas pseudomallei). Reservoirtiere sind Nager, Vögel und Reptilien.
Epidemiologie der Melioidose
Die Infektion kommt in einigen Regionen Südostasiens endemisch vor. Insbesondere werden regelmäßig Errankungen in Malaysia, Thailand, Vietnam, Kambodscha und Indonesien beobachtet. Sporadische Erkrankungen kommen zudem im Norden Australiens, in Afrika sowie Südamerika vor.
Infektionshäufungen treten meist während der Regenzeit auf. Die Übertragung des Keimes erfolgt durch Tröpfchen- und Schmierinfektion. Ein Eindringen des Erregers über Hautläsionen ist möglich. Kontakt mit kontaminiertem Erdreich oder aber eine orale Aufnahme des Erregers, z. B. beim Hand-Mund-Kontakt, gilt als möglicher Ansteckungsweg. Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch gilt als unwahrscheinlich. Erkrankungshäufungen wurden z. B. bei Kanalarbeitern in Singapur berichtet.
Klinik der Melioidose
Die Inkubationszeit (Zeit zwischen Infektion und Ausbruch der Krankheit) beträgt in der Regel nur wenige Tage. Allerdings wurden Verläufe beschrieben, bei denen die Erkrankung erst Monate nach dem Kontakt aufgetreten ist. Klinisch kommt es bei der Melioidose zunächst zur akuten fieberhaften abszedierenden Bronchopneumonie mit Husten, Dyspnoe (Atemnot) und Hämoptysen (Bluthusten).
Nach wenigen Tagen erfolgt dann eine generalisierte Aussaat der Erreger, wodurch es zur multiplen Abszessbildung in verschiedenen Organen kommt. Ohne Therapie verlaufen bis zu 40% der Infektionen letal (sterblich).
Verläufe, bei denen es nur zu einer geringgradigen Symptomatik kommt, sind möglich. Nach einer erfolgter asymptomatischer Primärinfektion und Erregerpersistenz kann es in Folge einer Immunsuppression, Steroidtherapie oder Neoplasien zur Aktivierung der Infektion kommen.
Therapie der Melioidose
Die Therapie erfolgt durch Verabreichung von Antibiotika. Erschwerend kommt eine zunehmende Resistenzentwicklung gegen dieses Bakterium hinzu. Als Mittel der Wahl wird Ceftazidim kombiniert mit Trimethoprim-Sulfamethozaxol, Tetrazyklinen oder Chloramphenicol über mindestens 3 Wochen empfohlen. Wichtig ist eine orale Erhaltungstherapie mit Amoxycillin-Clavulansäure für 2 bis 6 Monate. Alternativ sind Imipenem, Meropenem sowie Cefotaxim wirksam. Die Rezidivrate (Rückfall) beträgt bis zu 10%.
Ggf. kann operative Sanierung befallener Gewebe, wie z. B. eine Resektion eines betroffenen Lungensegmentes, notwendig sein.
Diagnose der Melioidose
Der Nachweis des Erregers erfolgt durch kulturelle Anzüchtung. Als neuere Methoden stehen Nukleinsäureamplifikationstests zum Nachweis der bakteriellen DNA von Burkholderia pseudomallei in spezialisierten Labors zur Verfügung. Der Nachweis von Antikörpern ist mittels diverser serologischer Methoden möglich, ist aber jedoch bei der Abklärung einer akuten Infektion in der Regel ohne Bedeutung.
Meldepflicht
Die Melioidose gilt nach dem Infektionsschutzgesetz als nicht meldepflichtig.
Letzte Aktualisierung am 25.02.2021.