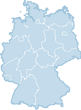Speichelstein
Ein Speichelstein kann den Ausführungsgang der Unterkieferspeicheldrüse oder Ohrspeicheldrüse verlegen und dadurch Beschwerden hervorrufen
Bei Speichelsteinen handelt es sich um Steinbildungen in einer Speicheldrüse und deren Ausführungsgängen. Das Krankheitsbild wird mit dem Fachbegriff Sialolithiasis bezeichnet. Eine Operation kann manchmal erforderlich sein, um den Stein zu entfernen.
Ursachen
Speichelsteine (Sialolithen) bilden sich oft bei geringem Speichelfluss und bei ungünstigen Konzentrationsverhältnissen von Salzen. Dies kann z. B. auch bei Erkrankungen der Speicheldrüse und manchmal bei Fremdkörpern der Fall sein. Eine Erkrankung, bei der die Ausbildung von Speichelsteinen gefördert wird, ist Mukoviszidose (Zystische Fibrose).
Die Steine bilden sich meist aus Kalziumphosphat oder Kalziumkarbonat.
Symptome
Am häufigsten bilden sich Speichelsteine in der Unterkieferspeicheldrüse (Glandula submandibularis). Die anderen Speicheldrüsen (Glandula parotis, Glandula sublingualis) können jedoch ebenso betroffen sein. Unter Umständen kann der Stein als Verhärtung ertastet werden.
Ein Speichelstein kann den Ausführungsgang verstopfen und daher zu einer schmerzhaften Schwellung der Speicheldrüse führen. Dies verstärkt sich insbesondere bei der Nahrungsaufnahme, wo es zu wellenförmig zu- und abnehmenden Schmerzen (Koliken) kommen kann. Da weniger Speichel austreten kann, kann mitunter ein trockener Mund bemerkt werden.
Als Folge der Verstopfung durch den Stein kann eine Entzündung in der Drüse entstehen (Sialadenitits). Auch kann sich ein Abszess, eine abgekapselte eitrige Entzündung, entwickeln, wodurch es zu weiteren Komplikationen kommen kann.
Diagnose
Es erfolgt eine Befragung des Patienten (Anamnese). Daraufhin wird eine körperliche Untersuchung, unter anderem durch Abtasten, durch den Arzt vorgenommen. Es wird versucht, die Speicheldrüsen auszumassieren, um den Sekretabgang zu beurteilen. Unter Umständen kann eine Sonde in den Ausführungsgang eingeführt werden. Bildgebende Verfahren wie Ultraschall, Röntgen (eventuell mit Kontrastmittel), Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT) werden durchgeführt. Bei Verdacht auf Speicheldrüsenentzündung wird ein Abstrich vorgenommen und im Labor auf Keime untersucht. Des Weiteren ist eine Hals-Nasen-Ohren-ärztliche Untersuchung erforderlich.
Differenzialdiagnose
In seltenen Fällen können Speichelsteine mit anderen Kalkablagerungen (z. B. bei Arteriosklerose, Ablagerungen in den Venen, Lymphknotenverkalkung) verwechselt werden. Ebenso müssen Tumore ausgeschlossen werden.
Therapie
Konservative Therapie
Wenn möglich, sollte der Speichelstein beseitigt und dabei die Drüse geschont werden. Bei einer Speicheldrüsenentzündung werden antibiotische Medikamente gegeben.
Zunächst sollte versucht werden, den Stein ohne eine Operation zum Abgang zu bringen. Dazu können z. B. speichelfördernde Maßnahmen ergriffen werden, z. B. das Lutschen einer Zitrone, das Kauen eines Kaugummis oder die Gabe von Medikamenten, die eine vermehrte Speichelausschüttung bewirken. Ein Steinabgang kann sich durch Massage der betroffenen Speicheldrüse ergeben. Eine Aufdehnung des Speicheldrüsengangs kann ebenso sinnvoll sein. In manchen Fällen kann der Stein mit speziellen Instrumenten oder durch Speicheldrüsengangs-Spiegelung (Endoskopie) entfernt werden.
Des Weiteren kann eine Zertrümmerung des Speichelsteins durch eine so genannte Lithotripsie möglich sein.
Operation
In einigen Fällen ist eine Operation als Behandlung des Speichelsteins angezeigt.
Der Eingriff kann in örtlicher Betäubung oder auch in Vollnarkose erfolgen.
Durch einen Schnitt in den Ausführungsgang wird der Speichelstein herausgeholt. Die Ausführungsgänge der Unterkiefer- und Unterzungenspeicheldrüse liegen am Boden des Mundes, die der Ohrspeicheldrüse in der Wangeninnenseite. Nur selten ist es notwendig, die Schlitzung des Ausführungsganges zu vernähen.
Selten ist bei schweren Entzündungen oder bei Verwachsungen um den Speichelstein herum eine Entfernung der kompletten Speicheldrüse notwendig. Dazu wird ein Hautschnitt im jeweiligen Drüsenbereich vorgenommen, und die Drüse wird freipräpariert und herausgenommen.
Mögliche Erweiterungen der Operation
Komplikationen und unvorhergesehene Befunde können es selten erforderlich machen, dass die Operationsmethode abgeändert oder erweitert wird.
Komplikationen
In den ersten Tagen nach einer Operation ist der Bereich häufig geschwollen und eventuell schmerzhaft. Umliegende Strukturen können geschädigt werden. Blutungen, Nachblutungen und Blutergüsse können auftreten. Es kann zu Infektionen beziehungsweise einem Abszess (abgekapselte eitrige Entzündung) sowie zu Wundheilungsstörungen mit Narbenbildung kommen. Der Gang kann erneut verengt werden. Bei einer Durchtrennung von Nerven kann es zu Taubheitsgefühl, Lähmungserscheinungen oder weiteren Ausfällen kommen, was zeitlich begrenzt, aber auch dauerhaft sein kann. Es können allergische Reaktionen auf verwendete Materialien und Substanzen vorkommen.
Hinweis: Dieser Abschnitt kann nur einen kurzen Abriss über die gängigsten Risiken, Nebenwirkungen und Komplikationen geben und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das Gespräch mit dem Arzt kann hierdurch nicht ersetzt werden.
Prognose
Schon mit nichtoperativen Maßnahmen ist es oftmals möglich, den Speichelstein zu beseitigen. Ist dies nicht der Fall, so gelingt durch die Operation in aller Regel eine Entfernung. Es kann jedoch zu einem Wiederauftreten (Rezidiv) eines Speichelsteins kommen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn eine veränderte Speichelzusammensetzung den Stein verursacht, z. B. bei Mukoviszidose.
Hinweise
Vor der Operation
Oftmals müssen vor einer Operation eines Speichelsteins Arzneimittel, die die Blutgerinnung hemmen, abgesetzt werden. Betroffen sein können beispielsweise Aspirin® oder Marcumar®. Das Weglassen geschieht immer in Rücksprache mit dem Arzt.
Bei einer solchen Operation darf, sofern sie in örtlicher Betäubung erfolgt, vier Stunden vorher nichts mehr gegessen und nicht mehr geraucht werden, und zwei Stunden vorher nichts mehr getrunken werden.
Die Zähne sollten vor dem Eingriff gewissenhaft geputzt werden.
Nach der Operation
Erfolgt die Operation unter ambulanten Bedingungen, so muss sich der Patient abholen lassen und darf innerhalb eines Tages keine Autos oder Maschinen bedienen. Ebenso sollten wichtige Entscheidungen vertagt werden.
Bis zum Verheilen der Schnittwunden im Mundraum sollte nur Wasser und Tee getrunken werden. Alkohol und Kaffee sollte gemieden werden, damit die Wunde nicht gereizt wird. Daraufhin dürfen Suppe und breiige Speisen gegessen werden. Der Mund sollte nach den Mahlzeiten ausgespült werden. Beim Zähneputzen ist besondere Vorsicht geboten.
Es sollte nach der Operation eine zu starke körperliche Betätigung gemieden werden. Kälteanwendungen sind förderlich für die Heilung, Wärme ist eher schädlich. Auch nach dem Eingriff sollte nicht geraucht werden, weil dadurch Wundheilungsstörungen gefördert werden.
Bei Auffälligkeiten, die auf Komplikationen hindeuten könnten, sollte umgehend der Arzt beziehungsweise die Klinik informiert werden.
aktualisiert am 16.11.2023